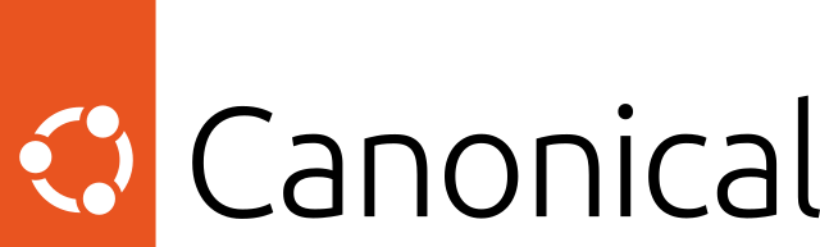Einen Tag später als erwartet hat Canonical die Beta-Version für das am 17. Oktober erwartete Ubuntu 19.10 »Eoan Ermine« für Desktop, Server und Cloud freigegeben. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, nehmen neben Ubuntu selbst auch Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, UbuntuKylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, und Xubuntu teil.
Aktueller GNOME Desktop
Allen Derivaten gemeinsam ist Kernel 5.3 als Basis. Bei Ubuntu kommt als Desktop-Umgebung das aktuelle GNOME 3.34 zum Einsatz. Damit kommen Nutzer der Intel-Plattform auch bei Ubuntu unter anderem in den Genuss eines flickerfreien Bootvorgangs. Zudem lässt sich die GNOME-Shell nun besser organisieren, indem Anwendungs-Icons per Drag&Drop zu Gruppen zusammengefasst werden können.
Zwei größere Änderungen
Ubuntu 19.10 ist ein Release mit lediglich neun Monaten Unterstützung. Bei diesen Veröffentlichungen werden gemeinhin größere Neuerungen eingeführt, die in diesem Fall bis zum April getestet werden, wenn Ubuntu 20.04 LTS erscheint. Zwei dieser größeren Änderungen waren für 19.10 angekündigt, die Beta enthält allerdings erst eine davon.
Nvidia-Treiber an Bord
Mit Ubuntu 19.10 können sich besonders Gamer darüber freuen, den proprietären Nvidia-Treiber jetzt zur einfachen Installation auf dem Installationsmedium vorzufinden. Auf die zweite Änderung war ich gespannt, versprach sie doch zumindest experimentell ein einfaches Aufsetzen von ZFS direkt aus dem Installer heraus.
ZFS fehlt im Installer
Zwar sind die nötigen Pakete dazu auf dem Image für den Ubuntu-Desktop vorhanden, die Integration in den Installer fehlt allerdings noch. Schuld daran sind wohl Unstimmigkeiten darüber, wie ZFS im Installer integriert werden soll. Bleibt also zu hoffen, dass hier noch nachgeliefert wird, um dieses Versprechen einzulösen. In den Release Notes findet sich allerdings nichts dazu.
Viel Kosmetik
Darüber hinaus bietet Ubuntu 19.10 hauptsächlich kosmetische Änderungen, wie etwa das überarbeitete Theme Yaru Light und neun neue Hintergründe aus dem Wallpaper-Wetbewerb. Bleibt abzuwarten, ob die Integration von ZFS, die in den Ausgaben für Server und Cloud bereits vorhanden ist, es noch in den Desktop schafft.
Ubuntu MATE vorne
Bei den Derivaten sticht wieder einmal Ubuntu MATE mit agiler Weiterentwicklung hervor. Hier kommt MATE Desktop 1.22.2 zum Einsatz. Compiz und Compton sind nicht mehr auf dem Image, können aber nachinstalliert werden. VLC wurde gegen GNOME MPV ausgetauscht, der neuerdings Celluloid heißt.
Xubuntu 19.10 basiert auf Xfce 4.14 und ändert ansonsten wenig. Auch bei Ubuntu Budgie 19.10 passiert kaum etwas, da kein neues Release des Budgie-Desktops vorliegt. Kubuntu setzt auf KDE Plasma 5.16, KDE Applications 19.04.3 und Qt 5.12.4. Neu im Angebot sind hier Apps wie Latte Dock und Kdenlive.
Ubuntu Studio bietet mit OBS Studio das beliebte Game-Streaming-Tool erstmals auf dem Image an. Zudem wurden die Ubuntu Studio Controls verbessert und zeigen nun den jeweiligen Zustand des Audio-Servers Jack an. Lubuntu, der Ableger mit dem LXQt-Desktop erwähnt auf der Ankündigung der Beta lediglich einen weiteren Wallpaper-Wettbewerb, dessen Ergebnisse vor dem Release am 17. Oktober noch hinzugefügt werden müssen. Links zum Download der verschiedenen Varianten gibt es auf der Webseite Get Ubuntu.