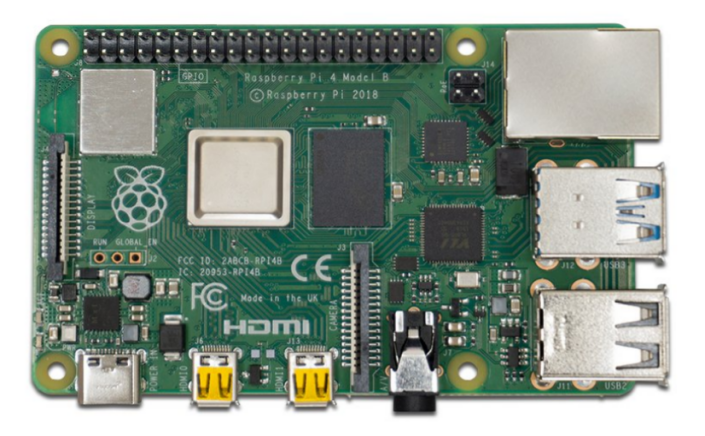Schon seit Längerem ist der Raspberry Pi nicht nur zu Hause und im Büro im Einsatz, sondern zunehmend auch in der Industrie, wo er etwa Automations- und Steuerungsaufgaben übernimmt oder als Testbasis für Proof-of-Concept (PoC) eingesetzt wird. Dafür stehen mehrere Modelle von Drittanbietern bereit, wie unter anderem der netPi, die auf Raspberry Pi oder Compute Module aufsetzen. Beim Absatz des Raspberry Pi macht der Industriebereich bereits 44 Prozent der Verkäufe aus.
Neue Angebote für Industriekunden
Dem tragen Raspberry Pi Foundation und deren kommerzieller Arm Raspberry Pi Trading Ltd nun Rechnung. Zwei neue Dienste und eine Erweiterung der Webseite sollen künftig Anlaufpunkte für Industriekunden sein. Der Dienst Approved Design Partners soll Kunden auf der Suche nach gangbaren Lösungen beim Designprozess ihrer Produkte mit professionellen Partnern zusammenbringen, die bei der Realisierung helfen. Die Raspberry Pi Ltd garantiert ihren Kunden aus der Industrie auf alle Produkte eine Lebensdauer bis mindestens 2026.
Compliance-Programm
Als zweiter Neuzugang soll der Dienst Raspberry Pi Integrator Programme Hemmnisse aus dem Weg räumen. Dahinter verbirgt sich ein Service zum Testen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Normen. Das Programm wurde entwickelt, um die Last der Navigation durch komplizierte Compliance-Probleme zu beseitigen und es für Unternehmen einfacher zu machen, ihre Produkte in kürzerer Zeit und mit geringeren Kosten auf den Markt zu bringen. Als Partner steht das Unternehmen UL den Kunden mit Rat und Tat zur Seite.
Webseite aktualisiert
Auch ein Teil der Webseite des Raspberry Pi spiegelt künftig unter dem Motto For Industry den Marktanteil des kleinen Rechners bei Industrieanwendungen wider. Dort erhalten Kunden Zugang zu Informationen und Unterstützung, die Sie beim Einsatz des Raspberry Pi in einer industriellen Umgebung benötigen, mit Verweisen zu Datenblättern, Konformitätsdokumenten und mehr.