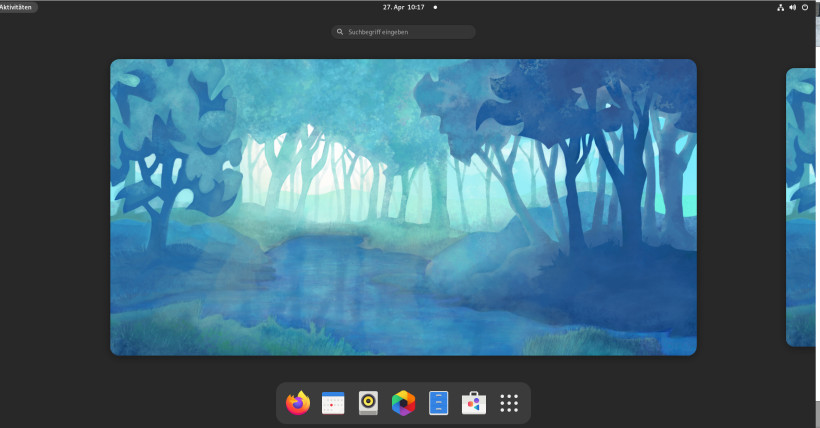Die Umrisse von Fedora 34, das derzeit für die Veröffentlichung am 20. April vorgesehen ist, werden langsam sichtbar, nachdem in den letzten Tagen einige Vorschläge aus dem umfangreichen Changeset akzeptiert wurden. So wurde diese Woche der im November 2020 mit Systemd 247 erstmals veröffentlichte Out-of-Memory Daemon (OOM) für alle Spins von Fedora 34 bestätigt und wird somit standardmäßig aktiviert sein.
Speicherverhalten verbessern
Der Code stammt ursprünglich von Facebook und wurde von den Systemd-Entwicklern für den Linux-Desktop angepasst. Das Ziel von systemd-oomd ist die Verbesserung des Verhaltens, wenn ein Linux-System insgesamt über wenig Speicher verfügt oder der verfügbare Speicher zur Neige geht.
Der Kernel verfügt zwar über einen OOM-Killer, der den Systemd-Entwicklern allerdings nicht effektiv genug arbeitete. Er reagiere zu spät und beende dann zu oft Prozesse gewaltsam. Systemd-oomd überwacht den Speicherbedarf von Cgroups und greift bei Bedarf mit dem Abschießen von Prozessen ein. Das Verhalten kann über definierte Schwellwerte in der Konfigurationsdatei oomd.conf gesteuert und auch gänzlich abgeschaltet werden.
Xwayland als eigenes Paket
Zudem hat Fedoras Steuerungskomitee FESCo dem Vorschlag zugestimmt, Fedora 34 mit einem eigenständigen XWayland auszuliefern. Die Upstream-Versionen von X.org hängen seit Jahren am aktuellen 1.20-Zweig fest, ohne dass ein zukünftiges größeres Update absehbar ist. XWayland erfährt dagegen eine Menge an Updates, die aber durch die Koppelung an X.org nicht bei den Anwendern ankommen. Das von X.org unabhängige Paket soll aus Git-Snapshots des aktuellen Upstream-Code gebaut werden. Technisch ist das nicht problematisch, da Xwayland keinen geräteabhängigen Treiber oder ein Modul hat, die zur Laufzeit geladen werden.
PipeWire übernimmt Audio
Bereits zuvor hatte FESCo dem Vorschlag zugestimmt, die Audioverarbeitung mit Fedora 34 an PipeWire zu übergeben. Derzeit wird die gesamte Desktop-Audio-Ausgabe vom PulseAudio-Daemon verwaltet. Anwendungen verwenden die PulseAudio-Client-Bibliothek, um mit dem PulseAudio-Daemon zu kommunizieren, der die Audioströme von den Clients mischt und verwaltet.
Mit Fedora 34 wird der PulseAudio-Daemon durch eine funktional kompatible Implementierung auf Basis von PipeWire ersetzt. Das bedeutet, dass alle vorhandenen Clients, die die PulseAudio-Client-Bibliothek verwenden, weiterhin wie bisher funktionieren, ebenso wie Anwendungen, die als Flatpak ausgeliefert werden. Auch im (semi)-professionellen Bereich übernimmt PipeWire den Job, der bisher vom Jack-Server erledigt wurde. Hier wird ein Ersatz für die JACK-Client-Bibliothek installiert, der direkt mit PipeWire kommuniziert. Alle Anwendungen, die bisher JACK verwendet haben, werden dann auf PipeWire arbeiten.
Weitere Änderungen
Weitere akzeptierte Änderungen betreffen die Verwendung von DNS Over TLS, ein GNU Toolchain Update sowie Updates zu LLVM 12 und OpenSSL 3.0. Als neuer offizieller Fedora-Spin wird ein Image des Fenstermanagers i3 angeboten. Noch nicht bestätigt ist unter anderem Wayland als Standard für den Plasma-Desktop-Spin von Fedora.