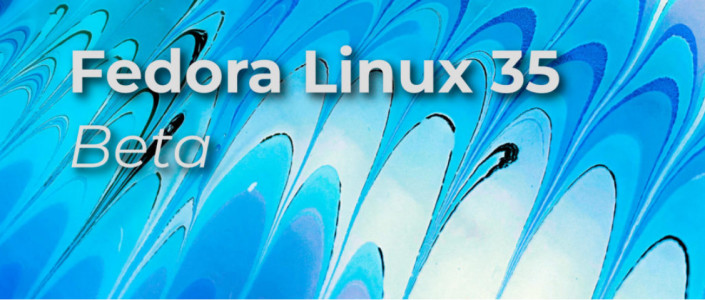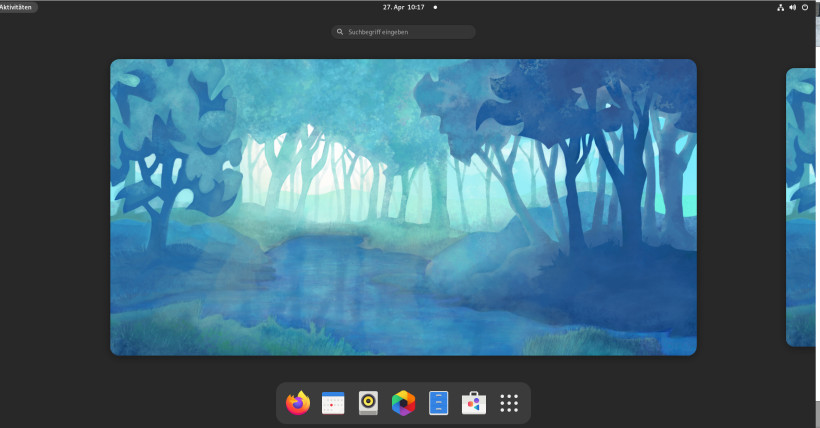Gestern erschien Fedora 35 offiziell. Während die neuen Features überschaubar sind, nutzte ich die Chance, mit der neuen Version ein Experiment einzugehen: Der Wechsel von der klassischen Workstation-Variante auf Fedora Silverblue. Diese Ausgabe soll laut eigener Vorstellung die Zukunft von Fedora darstellen.
Silverblue und Kinoite
Parallel zu Silverblue gibt es seit kurzem auch Kinoite mit dem gleichen Konzept, nur die Desktopumgebung ist dann KDE statt GNOME. Das Konzept wurde auf Linuxnews auch bereits ausführlicher erklärt: Sowohl Silverblue als auch Kinoite gehören zu den unveränderbaren (immutable) Betriebssystemen. Das erklärt sich dadurch, dass ihr Root-Dateisystem nur lesbar ist. Alle Änderungen werden außerhalb des Root-Dateisystems auf einer separaten Ebene gespeichert. Updates werden als komplettes Abbild ausgeliefert und lassen sich somit zurückrollen auf einen vorherigen Stand.
Für Software-Installationen gibt es drei Wege, der »klassische« Weg über den Paketmanager dnf entfällt dabei allerdings. Stattdessen soll die Anwendungsinstallation bevorzugt über Flatpaks stattfinden. Entwicklerwerkzeuge lassen sich über die »Toolbox« installieren, die Container-basiert ist. Über RPM/OSTree lassen sich aber schließlich auch noch klassische RPMs installieren.
Warum der Aufwand? Auch die neuen Versionen sollen sich anfühlen und verhalten wie eine normale Distribution, aber zugleich das Betriebssystem stabil und unveränderlich machen durch die strikte Trennung zwischen System und Anwendung. Das erinnert an die mobilen Betriebssysteme. Für die kommende Zeit möchte ich diese Zukunft ausprobieren und von meinen Erfahrungen als »klassischer« Anwender berichten.
Instalation mit Troubleshooting
Auch für die Installation soll gelten, dass diese wie bei einer normalem Distribution aussieht und sich so verhält. Dafür wird der klassische Installationsmanager von Fedora genutzt. Allerdings unterscheidet sich die Installation bei mir in einem wesentlichen Punkt: Sie bricht bei mir mit Fehlermeldungen ab. Der Fehler ist auf EFI-Systemen bekannt, wenn weitere Betriebssysteme installiert sind. Workarounds werden angeboten, funktionieren bei mir aber nicht wirklich. Anstelle von allzu umfangreichem Troubleshooting entschließe ich mich daher, Silverblue meine ganze Platte zu geben und mein Dualboot damit aufzulösen.
Einrichten: Viele Flatpaks
Silverblue wird sehr spartanisch ausgeliefert, es richtet sich schließlich gegenwärtig noch an erfahrene Nutzer. Auch der Software-Store (GNOME Software) ist zu Beginn noch recht überschaubar ausgestattet. Erstaunlich ist, dass man beim Starten zwar gefragt wird, ob man auch Flathub.org als Software-Quelle hinzufügen möchte, dies aber scheinbar nur für ausgewählte Pakete für Flathub gilt. Das ist wenig transparent, letztlich lässt sich aber auf gewohntem Wege Flathub freischalten.
Dank Flathub steigt die Auswahl an Software auch spürbar an, bislang vermisse ich keine Anwendung. So wirklich gut gelöst ist die Softwareinstallation über GNOME Software allerdings nicht. Im Gegensatz zu Fedora 34 ist das Programm für mich immerhin praktisch nutzbar, wenngleich sich mir manche Ladevorgänge noch immer nicht erschließen. Außerdem wird etwa der Firefox mit zwei separaten Einträgen in GNOME Software gelistet und mir werden insgesamt drei Installationswege angeboten: Vorinstalliert ist ein RPM, außerdem habe ich die Möglichkeit als Flatpak über Flathub oder als Flatpak über Fedora. Die konkrete Quelle herauszufinden gelingt mal auf den ersten Blick, mal nur in den tieferen Informationen beim Durchklicken. Das ist suboptimal gelöst, vor allem die Tatsache, dass Fedora ein eigenes Flatpak-Repository pflegt, statt in Flathub einzupflegen, läuft der Idee von Flatpaks ein Stückchen zu wider.
Grundsätzlich sind Flatpaks ein Thema für sich, da gibt es unterschiedliche, aber gleichsam legitime Meinungen. Ich persönlich habe kein Problem mit Flatpaks, nur hätte ich sie gerne aus einer zentralen Quelle, die eine gute Qualitätssicherung hat. Beides ist in meinen Augen im Augenblick nicht gegeben: Weder ist es bislang zentral auf Flathub, noch ist dort besonders transparent, ob dort eine Qualitätssicherung stattfindet. Dem kann man natürlich entgegenhalten, dass dies bei klassischen Dritt-Quellen ebenfalls nicht der Fall ist und auch in den Repositorys oft veraltete Software liegt.
Die Verwendung der Flatpak-Applikationen funktioniert im Alltag bei mir gut. Ich habe keine Latenzen. Lediglich muss einem bewusst sein, dass Flatpaks gelegentlich Restriktionen haben, beispielsweise wenn man auf Dateien abseits des Home-Verzeichnisses zurückgreifen möchte. Diese Restriktionen wurden allerdings bewusst eingefügt und lassen sich auch umkonfigurieren bei Bedarf.
Manipulation am System möglich, aber nervig
Allerdings gibt es auch Pakete, die keine Flatpaks sind. So waren es bei mir die Druckertreiber, Multimedia-Codecs und tlp, da bei mir die neuen Energie-Optionen aus GNOME 41 leider nicht als Alternative reichten. Was sonst alles durch die Kommandozeile fix erledigt ist, funktioniert mit Silverblue so nicht mehr. Immerhin, ist das Paket in Paketquellen hinterlegt, so funktioniert die Installation mittels rpm-ostree install. Danach ist nur noch ein Neustart erforderlich. Die Anzahl an notwendigen Neustarts kann man auch noch erhöhen: Für Multimediacodecs müssen unter Fedora Repositorys freigeschaltet werden, die ebenfalls erst nach einem Neustart funktionieren. Anschließend wird nach der Installation noch einmal ein Neustart durchgeführt.
Nervig wird es auch, wenn man vom Hersteller ein Paket für beispielsweise Treiber bekommt. Denn dann gilt auch hier: Abhängigkeiten installieren, Neustart, Paket installieren, Neustart.
Sicherlich, es ist ja eben Sinn und Zweck von Silverblue, Manipulationen am System so stark wie möglich zu reduzieren. Dennoch macht es in meinem Falle die Einrichtung meines Systems erst mal deutlich langwieriger, als wenn ich schnell meine eigene Checkliste abarbeite und mit Copy & Paste altbewährte Befehle nutze.
Die Zukunft?
Ist das nun die Zukunft? An Fedora schätze ich eigentlich, dass ich bei jedem Release ein weitestgehend rundes Paket bekomme, welches ich schnell installieren und dann nur noch kurz einrichten muss, wenn es um das Nachrüsten von Codecs, tlp und dem Druckertreiber geht. Dieser Prozess hat jetzt erst mal länger gedauert. Und auch die gesamte Installation wurde durch bekannte Bugs gestört.
Ist man bei den alltäglichen Aufgaben, so fühlt sich Silverblue an wie jedes andere Linux-System mit GNOME. Da bin ich bislang auf keine Probleme getroffen. Die Ansätze für ein anwenderfreundlicheres Betriebssystem sind klar erkennbar: Alte Linux-Hasen nutzen gerne die Kommandozeile und das auch vollkommen zu Recht. Allerdings wird gerne mal vergessen, dass dies wenig technikaffinen Anwendern schnell zum Verhängnis wird, weil sie bei für manch ein Programm nicht umhinkommen, das Terminal zu nutzen oder bei dem Copy & Paste aus Internetanleitungen sich das System zerschießen. Ein funktionierender Software-Store, der auf Flatpaks zurückgreift und OSTree können diese Probleme lösen. Während für diese Anwender Silverblue noch aus Kinderkrankheiten herauswachsen muss, werden bei mir die kommenden Wochen zeigen, wie praktikabel das System im Alltagseinsatz sein wird und ob ich mit der »Toolbox« etwas anzufangen weiß.