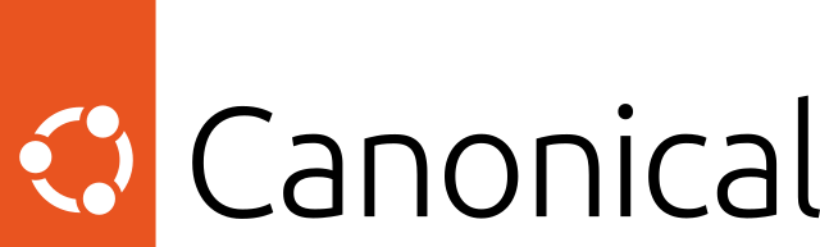Pünktlich wie gewohnt erschien nach der Beta-Version von Anfang April am 23. April die neue langzeitunterstützte Ausgabe von Ubuntu mit der Bezeichnung Ubuntu 20.04 LTS »Focal Fossa«. Sie bietet Unterstützung für fünf Jahre, die kostenpflichtig weiter verlängert werden kann. Anwender können sich beim Umstieg Zeit lassen, denn Ubuntu 18.04 wird noch bis April 2023 unterstützt.
Familienfeier
Diese Veröffentlichung bietet nicht nur Abbilder für Ubuntu-Desktop-, Server- und Cloud, sondern auch für Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio und Xubuntu. Als Grundgerüst dienen GNOME 3.36 und Kernel 5.4, der ebenfalls Langzeitunterstützung erhält. Die Entwickler haben zudem die frisch in Kernel 5.6 aufgenommene VPN-Tunnel-Software WireGuard nach 5.4 zurückportiert.
Yaru-Theme überarbeitet
Optisch ist neben dem neuen Wallpaper und dem überarbeiteten Yaru-Theme mit Lila als Akzentfarbe ein Dark-Mode hinzugekommen, der unter Einstellungen ⇨ Darstellung ausgewählt werden kann. Die von Beginn an umstrittene Amazon-App wird mit Ubuntu 20.04 LTS endlich entfernt und schafft mehr Platz im Dock.
Ein Nicht-Stören-Modus beschneidet bei Bedarf die Fülle an Benachrichtigungen und zeigt nur noch wichtige Meldungen an. Ubuntu 20.04 unterstützt zudem initial den Raspberry Pi 4 und verbessert die Unterstützung für ältere RasPis bis hinunter zum Raspberry Pi 2 Model B.
Aus Nautilus wird Files
Ubuntu 18.04 lieferte eine ältere Version des Dateimanagers Nautilus aus, da neuere Versionen keine Icons auf dem Desktop mehr erlaubten. Dieses Problem ist mittlerweile anderweitig gelöst und somit bringt 20.04 eine aktuelle Version der mittlerweile Files oder in der deutschen Lokalisation Dateien genannten App mit vielen kleinen Verbesserungen. So lassen sich etwa favorisierte Dateien und Ordner markieren und jederzeit leicht wiederfinden. Die Darstellung der Ansicht bei Größenänderungen des Fensters wurde optimiert.
Beim Anstecken von USB-Sticks, externen Festplatten oder SD-Karten werden diese nun im Dock angezeigt und lassen sich von dort öffnen oder sicher entfernen. Um diese Anzeige zu unterbinden, muss etwas umständlich der dconf-Editor bemüht werden.
Flatpak und Snap
Freunde von App-Formaten wie Flatpak oder Snap werden sich über die erweiterten App-Berechtigungen freuen, die über Einstellungen ⇨ Anwendungen verfügbar sind. Weniger erfreulich finde ich, dass das die grafische Paketverwaltung GNOME Software, die hier Ubuntu Software heißt, standardmäßig als Snap installiert wird. Dem Snap-Paket fehlt nämlich die Unterstützung für Flatpak – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Abhilfe schafft nur die nachträgliche Installation von Ubuntu Software als DEB-Paket oder das Administrieren von Flatpak auf der Kommandozeile.
ZFS noch experimentell
Weiterhin experimentell, aber erheblich ausgebaut zeigt sich die mit Ubuntu 19.10 eingeführte Unterstützung für ein ZFS-Dateisystem auf der Root-Partition. Das eigens entwickelte Verwaltungs-Tool Zsys beherrscht die Erstellung von Snapshots bei Installation von Paketen oder dem Upgrade des Systems. Über diese Snapshots kann bei Problemen aus dem Boot-Manager GRUB heraus das System auf einen funktionierenden Stand zurückgerollt werden.
Änderungen in letzter Minute gab es für die Server-Variante. Hier übernahm der seit 2017 in der Entwicklung befindliche Installer Subiquity die Position des bisher verwendeten Debian-Installers. Damit lassen sich RAID-Systeme besser verwalten, da nun mehrere EFI System Partitionen (ESP) unterstützt werden.
Optisch gelungen
Ubuntu 20.04 LTS macht optisch was her und bringt mehr Neuerungen als für ein LTS-Release üblich. Desktop-Anwender profitieren von Funktionen, die für die zahlende Kundschaft auf Servern und in der Cloud vorangetrieben werden. Mit Snaps als Ersatz für die herkömmlichen DEB-Pakete wird weiter experimentiert. Die bisher als Snap ausgelieferten kleinen Apps wurden gegen den größeren Brocken Ubuntu Software als Snap ausgetauscht.
Auf Unternehmen ausgerichtet
Damit verfolgt Canonical klar den für Unternehmen wichtigen Sicherheitsaspekt, den solchermaßen in Sandboxen eingesperrte Apps bieten können. Ein weiteres in diesem Umfeld wichtiges Attribut ist die Unterstützung von Secure Boot, dem auf dem Desktop weniger Bedeutung zukommt. Hier und an weiteren Punkten wird klar, dass die Entwicklung von Ubuntu mittlerweile mit Fokus auf Unternehmen stattfindet. Das ist aber bei der Symbiose von Red Hat und Fedora kaum anders. Wenn es also auch dem Desktop-Anwender zugutekommt, warum nicht. Die Download-Links zu den einzelnen Abbildern finden sich in den Release Notes.