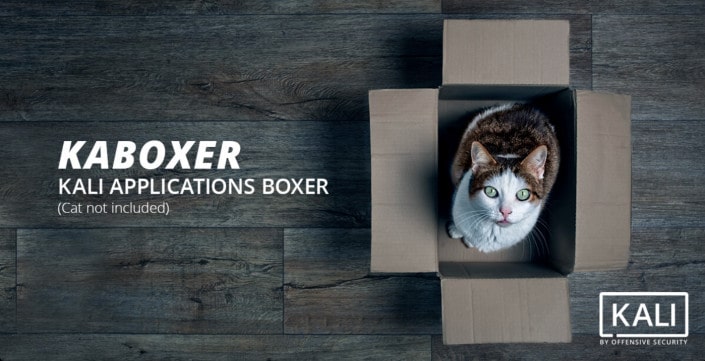Muse Group als die neuen Besitzer des beliebten freien Audioeditors Audacity legen es weiterhin darauf an, Anwender und Entwickler vor den Kopf zu stoßen. Nachdem durch massiven Protest der Community die Einführung von Telemetrie per Google Analytics und Yandex Metrica abgewendet werden konnte, folgt nun der nächste Streich von Martin Keary, dem Vorstandsvorsitzenden der Muse Group.
Unterschrift zu CLA zwingend erforderlich
Wer in der Vergangenheit zu Audacity beigetragen hat oder künftig beitragen möchte, muss ein Contributor License Agreement (CLA) unterzeichnen, wie aktuell auf GitHub zu lesen ist. Zudem soll die ursprüngliche Lizenz von GPLv2 auf GPLv3 geändert werden, um beispielsweise Technologien wie das per Dual-Lizenz aus GPLv3 und der Proprietary Steinberg VST3-Lizenz gestellte Virtual Studio Technology in Version 3 zu unterstützen, das mit der GPLv2 nicht kompatibel ist.
Mehrfachlizenzierungen ermöglichen
Das nun eingeführte CLA soll solche Mehrfachlizenzierungen in Zukunft erleichtern. Mit der Änderung auf die GPLv3 wird Audacity auch an MuseCore angepasst, einer Anwendung, die ebenfalls zur Muse Group gehört. Zudem soll Audacity auf weiteren Plattformen zugänglich gemacht werden, was angeblich ohne CLA nicht möglich ist. Als Beispiel wird Apples App Store genannt, was aber, wie ein Kommentator berichtet, nicht zutrifft, wie das Beispiel Nextcloud belegt.
Entmündigt
Beitragende, die die CLA für Audacity unterschreiben, treten damit »eine unbefristete, nicht-exklusive, weltweite, voll bezahlte, gebührenfreie, unwiderrufliche Urheberrechtslizenz zur Vervielfältigung, Erstellung abgeleiteter Werke, öffentlicher Darstellung, öffentlicher Aufführung, Unterlizenzierung und Verteilung des Beitrags und solcher abgeleiteter Werke« an das Unternehmen MUSECY SM LTD ab. Der Schaden, denn ein CLA anrichten kann, wurde von Drew DeVault während der letzten großen Diskussion über CLAs bereits dargelegt.
Das Ausschlachten geht weiter
Die neuen Besitzer planen zudem die Einführung separater Cloud-Dienste, die Audacity-Benutzer nutzen können, wenn sie wollen. Diese Dienste sollen die zukünftige Entwicklung von Audacity finanzieren, ähnlich wie MuseScore.com die Entwicklung der MuseScore-Kompositionssoftware finanziert. Der Text des CLA kann in der FAQ im Anhang der Ankündigung nachgelesen werden. Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt und wann ein Fork die Community unter einem nicht von der Geschäftemacherei der Muse Group verhunzten Audacity vereint.