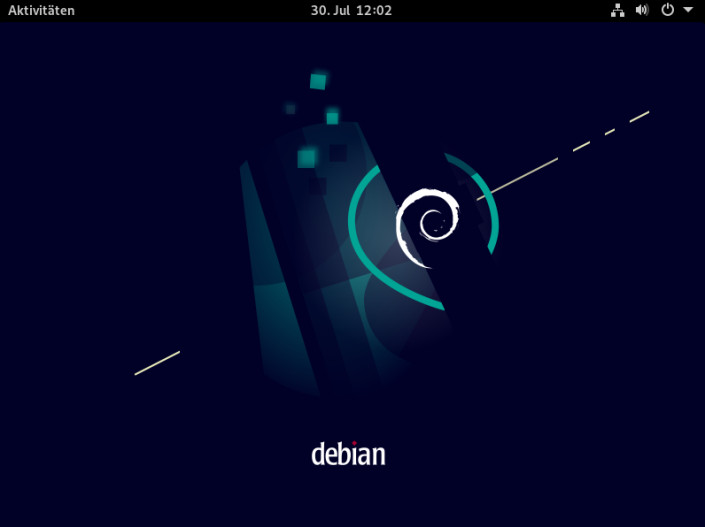Debian ist ein freies Betriebssystem auf der Basis des Linux Kernels, ausgestattet unter anderem mit den Werkzeugen des GNU-Projekts. Es wurde im August 1993 von dem inzwischen verstorbenen Ian Murdock ins Leben gerufen und wird seitdem aktiv weiterentwickelt. Es ist zudem die letzte große Distribution, die keinem Unternehmen nahesteht und völlig unabhängig entwickelt wird.
16. offizielle Ausgabe
Nach den Vorabversionen RC1 vom 23. April und RC2 vom 14. Juni 2021 hat das Debian-Release-Team heute mit GNU/Linux Debian 11 »Bullseye« die nächste Version des universellen Betriebssystems freigegeben. Es handelt sich dabei um die 16. offizielle Ausgabe der Distribution, die im Schnitt alle zwei Jahre erscheint. Die Universalität von Debian unterstreichen die rund 1.000 offiziellen Entwickler mit der Unterstützung von diesmal neun Architekturen:
- 32-bit PC (i386) und 64-bit PC (amd64)
- 64-bit ARM ( arm64 )
- ARM EABI ( armel )
- ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf )
- little-endian MIPS ( mipsel )
- 64-bit little-endian MIPS ( mips64el )
- 64-bit little-endian PowerPC ( ppc64el )
- IBM System z (s390x)
Die Unterstützung für Mips-32-Bit CPUs wird mit Debian 11 fallen gelassen.
Homeworld Theme
Das Erste, was dem Anwender bei Debian 11 auffallen wird, ist das neue Theme Homeworld von Juliette Taka, die damit bereits zum dritten Mal einen Wettbewerb um das Artwork einer Debian-Veröffentlichung gewinnt. Homeworld ist ein Thema, das von der Bauhaus-Bewegung inspiriert ist, einem Kunststil, der im 20. Jahrhundert in Deutschland entstand und sich durch seine einzigartige Herangehensweise an Architektur und Design auszeichnet. Taka sagte dazu: »Da Architektur und Design das Herzstück bei der Erstellung von Software sind, wollte ich eine Brücke zwischen diesem Kunststil und Debian schaffen.«
Mehr als 11.000 neue Pakete
Debian 11 wird mit dem aktuellen LTS-Kernel 5.10 ausgeliefert. Die Veröffentlichung enthält wieder viel mehr Software als der Vorgänger »Buster«; die Distribution enthält über 11.290 neue Pakete, was zu einer Gesamtzahl von 59.551 Paketen führt. Der größte Teil der Software in der Distribution wurde aktualisiert: über 42.820 Software-Pakete (das sind 72 % aller Pakete in »Buster«). Außerdem wurde eine beträchtliche Anzahl von Paketen (9.519, 16 % der Pakete in »Buster«) aus verschiedenen Gründen aus der Distribution entfernt. Das Release besteht aus 1.152.960.944 Zeilen Code und es haben insgesamt 6.208 Menschen dazu beigetragen.
GNOME 3.38.5 und Plasma 5.20
Bei den Desktop-Umgebungen wird Debian 11 unter anderem mit GNOME 3.38.5 ausgeliefert. Für GNOME 40 war es den eher konservativen Debian-Entwicklern noch zu früh. Das werden viele Anwender begrüßen, die sich mit dem neuen Bedienschema noch nicht anfreunden können. Dafür ist aber KDE Plasma mit 5.20 auf relativ aktuellem Niveau. LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24 und Xfce 4.16 sind die weiteren angebotenen Desktops. Bei den Office-Paketen wurde LibreOffice auf 7.0 aktualisiert, während Calligra in Version 3.2 ausgeliefert wird. Weitere aktualisierte Pakete sind GCC 10.2, LLVM/Clang 9.0.1 und 11.0.1, Apache 2.4.46, Nginx 1.18, MariaDB 10.5, PHP 7.4, Perl 5.32, OpenSSH 8.4p1, OpenJDK 11, Python 3.9.1, Samba 4.13, Vim 8.2, Gimp 2.10.22 und Inkscape 1.0.2.
Drucken ohne Treiber
Das treiberlose Drucken und Scannen wird für Bullseye weiter forciert durch das neue Paket ipp-usb, dass das Hersteller-neutrale IPP-over-USB-Protokoll verwendet, das von vielen modernen Druckern unterstützt wird. Dadurch kann ein USB-Gerät wie ein Netzwerkgerät behandelt werden, wodurch das treiberlose Drucken auf USB-angeschlossene Drucker ausgeweitet wird. Praktische Anleitung bietet das Debian-Wiki.
Erhöhte Passwortsicherheit
Die Passwortsicherheit soll mit Debian 11 besseren Schutz gegen wörterbuchbasierte Angriffe zum Erraten von Passwörtern bieten. Der bisher als Standard-Verschlüsselungsalgorithmus genutzte SHA512_Crypt wird nun durch ein wesentlich moderneres und sichereres Verfahren namens yescrypt ersetzt, das auch bei Fedora 35 zum Einsatz kommen soll. Und dieses ist explizit inkompatibel zu allem Vorangegangenen, weshalb Debian empfiehlt, lokale Passwörter über den Befehl passwd neu zu setzen.
Natives exFAT
Bei den Dateisystemen erhält exFAT erstmals native Unterstützung durch den Kernel, was sich in einem einfacheren Mounten ohne FUSE ausdrückt. Das neue Paket exfatprogs erlaubt zudem das Anlegen von exFAT-Partitionen. In Bullseye verwendet systemd standardmäßig control groups v2, das eine einheitliche Hierarchie zur Ressourcenkontrolle bereitstellt. Es sind Kernel-Parameter verfügbar, um notfalls die alte cgroups-Variante wieder zu aktivieren. Und wo wir schon bei Systemd sind: Es aktiviert in Bullseye standardmäßig die Funktion für ein dauerhaftes Journal und speichert seine Log-Dateien in /var/log/journal/. Der neue Befehl open ist jetzt als komfortable Alternative zum bisherigen Standard xdg-open verfügbar und über das update-alternatives-System konfigurierbar.
Unfreie Firmware besser unterstützt
Wie der Umstieg von Debian 10 auf 11 verläuft, hatte ich bereits vor zwei Wochen beschrieben. Wer neu installiert, kommt im Installer in den Genuss einer Neuerung, die die Installation auf moderner Hardware erleichtern soll. Neben der verbesserten Dokumentation über unfreie Firmware kann der Installer von Debian 11 bei den inoffiziellen Installer-Abbildern die dort ausgelieferte Firmware automatisch installieren. Dabei wird über eine Zuordnung der Hardware-ID zu Firmware-Dateien detektiert, ob vorgefundene Hardware Firmware erfordert. Bullseye ist die letzte Debian-Version, die apt-key enthält. Die Schlüsselverwaltung sollte stattdessen über Dateien erfolgen, die in /etc/apt/trusted.gpg.d abgelegt werden.
Entwicklung zu Debian 12 startet heute
Abbilder für frische Installationen liegen wie gewohnt als Live-Medium zum Testen und als Installer auf Debians Download-Server. Docker-Images von Bullseye sind auf dem Docker-Hub zu finden. Während Bullseye seine Reise gerade erst antritt, stehen bereits die Namen seiner zwei Nachfolger fest. Debian 12 wird »Bookworm« heißen und vermutlich 2023 erscheinen, während Debian 13 für 2025 zu erwarten ist und auf den Beinamen »Trixie« hört. Die Release Notes gehen detailliert auf die Änderungen ein.
Debian LTS für Debian 10
Mit der Veröffentlichung von Debian 11 beginnt im Testing-Zweig auch gleichzeitig die Entwicklung von Debian 12 »Bookworm«. Das bedeutet übrigens nicht, dass Debian 10 »Buster« nicht mehr unterstützt wird. Debian unterstützt die vorherige Version für mindestens zwölf Monate nach einer neuen Veröffentlichung, bevor sie an die LTS- und eLTS-Teams zur weiteren Pflege übergeben wird.