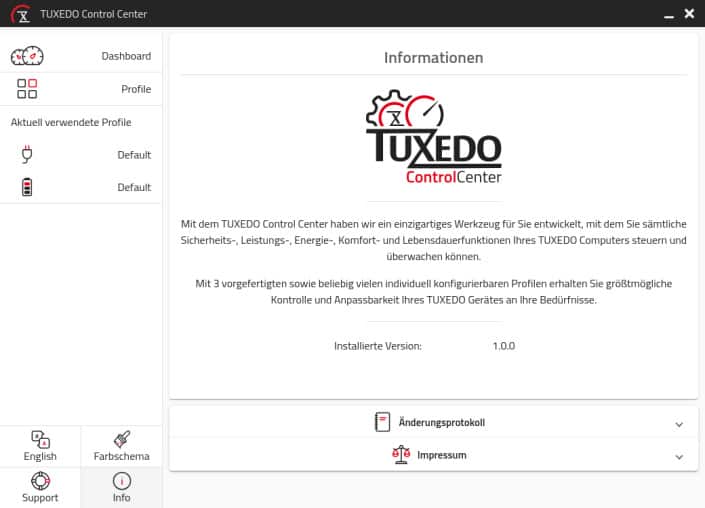Die Woche hier im Blog war bestimmt von euren Geschichten, wie ihr zu Linux gefunden habt und wie euer Weg mit Linux verlief. Nochmals vielen herzlichen Dank für die vielen tollen Geschichten! Ich habe noch rund 20 auf Lager, aber ihr dürft gerne weiterhin welche einsenden. Aber nun zu den Ereignissen da draußen in dieser Woche.
Distributionen
Bei den Rolling Release Distributionen wurden neue Abbilder für Arch Linux und dessen Ableger Obarun veröffentlicht, wobei Letzteres auf Systemd verzichtet. Ebenfalls rollend kommt EndeavourOS daher. Barry Kauler, seines Zeichens Erfinder von Puppy Linux, hat neue Abbilder seiner minimalistischen Distribution EasyOS freigegeben. Ebenfalls minimalistisch ist Alpine ausgelegt, das in Version 3.13.6 erschienen ist und unter anderem die Grundlage von postmarketOS bildet.
Nitrux 1.6.0 kommt wie gehabt mit dem NX Desktop-Aufsatz für KDE-Plasma. Neu bei der mexikanischen Distribution ist zudem ein eigener AppImage-Store. Als weitere KDE-zentrierte Distribution hat KDE neon frische Abbilder bereitgestellt. LibreELEC erreicht Version 10 und setzt auf das Mediencenter Kodi 19 »Matrix« auf. Das unabhängige 4M Linux 38.0 Beta bietet sich für leistungsschwache Rechner an. Der Buchstabe M steht für verschiedene Ausgaben der Distribution, die Maintenance, Multimedia, Miniserver und Mystery (Gaming) abdecken. Das Genode OS-Framework erreicht Version 21.08. Der Ansatz basiert auf keiner bestehenden Betriebssystem-Architektur und kann als Basis für Betriebssysteme für Desktop, Tablets, Smartphones oder Virtuelle Maschinen dienen.
Anwendungen, Desktops und Frameworks
Der Plasma Desktop erreichte mit 5.22.5 das letzte Bugfix-Release, bevor am 7. Oktober Plasma 5.23 erscheint. Das kurz bevorstehende Qt 6.2 LTS, das vermutlich im nächsten Jahr die Grundlage von Plasma 6 darstellt, soll in etwa Funktionsgleichstand mit Qt 5.15 LTS bieten. Systemd 249.4 und Flatpak 1.10.3 erblickten in dieser Woche das Licht der Linuxwelt ebenso wie Python 3.9.7, Blender 2.93.5 und Qbittorrent 4.3.8. Podman, eine Docker-Alternative von Red Hat steht in Version 3.3 für Container-basierte Arbeitsabläufe bereit. Einer der gravierenden Unterschiede ist, das Podman keinen Rootzugang benötigt. In Version 3.x hat Podman zudem gelernt, Docker Compose-Dateien zu verwenden.
CloudLinux bietet über seinen TuxCare Extended Lifecycle Service jetzt neben CentOS 6, Oracle Linux 6, und Ubuntu 16.04 auch Unterstützung für CentOS 8 bis Ende 2025 an. Die Bugfixes für KDE für diese Woche beseitigen viele Fehler für die Wayland Session und Entwickler Nate Graham ist der Meinung, Wayland habe ausreichend Stabilität für Plasma-Sitzungen erreicht, solange es nicht um Anwendungen aus dritter Hand geht.
Und sonst noch…
Letztens erklärte ein Kommentator dieses Blog als KDE-lastig. Dem möchte ich entgegentreten, auch wenn ich seit Langem begeisterter Anwender von KDE-Software bin. Der Grund, der einen solchen Eindruck entstehen lässt ist, dass bei KDE einfach mehr Futter für Nachrichten zugänglich ist. Deshalb für die Gnomies hier ein Trostpflaster: 20 GNOME Erweiterungen für GNOME 40.
Die LibreOffice Conference 2021 läuft vom 23. bis 25. September. Mozilla hat seinen VPN-Dienst einem unabhängigen Audit durch Cure53 unterzogen und dessen Ergebnisse jetzt veröffentlicht. Das Blog My-IT-Brain beschäftigt sich mit der Frage, warum man Linux-Container einsetzen sollte oder auch nicht. Und schließlich geht es noch um die Frage, wie es heutzutage um Unix steht.
Das war’s von mir für diese Woche. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Ab dem 13. September tausche ich für 10 Tage den Schreibtischsessel gegen den Fahrradsattel. Das bedeutet weniger News und an manchen Tagen auch mal gar keine. Wir werden sehen. Ansonsten, bitte bleibt gesund!