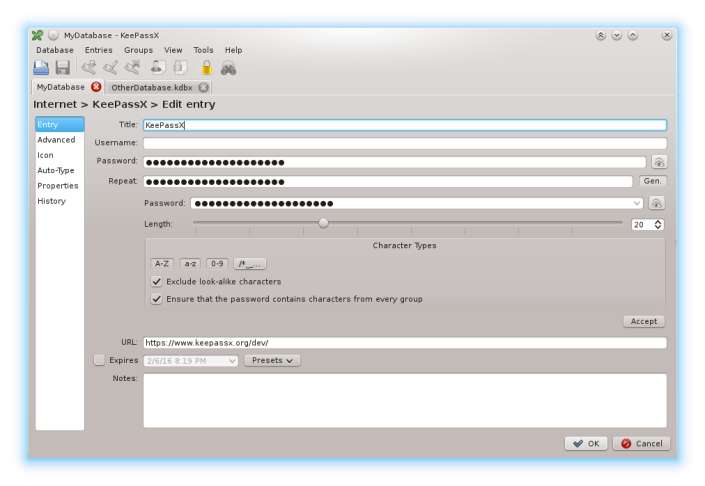Kaisen Linux ist eine Linux-Distribution, die für SysAdmins und andere IT-Profis entwickelt wurde, um Fehler eines installierten Betriebssystems zu diagnostizieren und zu beheben. Kaisen Linux bietet alle notwendigen Werkzeuge für die Diagnose und Behebung von Fehlern, die Wiederherstellung verlorener Daten, die Behebung von Boot-Problemen, die Formatierung von Festplatten und vieles mehr.
MATE als Standard
Kaisen Linux erschien erstmals auf den Tag genau vor zwei Jahren und ist gerade in Version 2.0 vorgelegt worden. Es handelt sich um ein Rolling Release auf der Basis von Debian Testing. Somit basiert die neue Version auf Debian 12 »Bookworm«. Die Standard-Desktop-Umgebung ist MATE, darüber hinaus werden Abbilder für KDE Plasma und Xfce ausgeliefert. Lxde wird bei Kaisen 2.0 durch LXQt ersetzt. Lxde ist weiterhin installierbar, wird aber mit Kaisen 3.0 in frühestens 18 Monaten aus den Repositories entfernt.
Neue Tools für die Cloud
Bei den Anwendungen und Tools werden unter bei Verwendung von Btrfs die Btrfs Snapshot Tools hinzugefügt. Für Cloud-Arbeiter kommen unter anderem Terraform, Trivy, Kubernetes, k6, k9s hinzu. Des Weiteren wurde das Menü vereinfacht und mit moderneren Icons versehen. Der optische Auftritt des Systemmonitors Conky wurde unter allen Desktops vereinheitlicht.

USB mit Persistenz
Gemäß seiner Bestimmung als Werkzeug für SysAdmins und andere IT-Profis lässt sich Kaisen mit Persistenz bootfähig auf einen USB-Stick übertragen. Der Vorgang wurde vereinfacht und ein Fehler beim Booten behoben. Ein spezielles System-Rescue-Abbild ist jetzt so konzipiert, dass es im Konsolenmodus startet und Xfce als grafische Benutzeroberfläche bei Bedarf mit einem Befehl gestartet werden kann.
ZSH oder Bash
Wird beim Netinstall-Abbild keine grafische Benutzeroberfläche ausgewählt, wird Bash als Standard für den Benutzer festgelegt, der während der Installation angelegt wird. Wenn eines der Metapakete zur Installation einer GUI oder das Paket kaisen-skeleton installiert wird, wird das Profil automatisch für alle Benutzer kopiert und ZSH als Standard eingestellt.
Apparmor und passende Standardprofile wurden der Distribution hinzugefügt. Die Apparmor-Verwaltungstools und -Profile wurden standardmäßig in die Live-Installationen integriert, beim Netinstall werden sie zur Installation angeboten. Das Paket kaisen-interfaces-common installiert sämtliche Werkzeuge, die in jeder unterstützten Desktop-Umgebung verfügbar sind.
Kaisen 2.0 kann auf Deutsch lokalisiert installiert werden, allerdings sind die Übersetzungen im Boot-Menü im Gegensatz zum Rest des Systems nicht sonderlich gelungen. Die Abbilder für die Desktops MATE, KDE Plasma, Xfce und LXQt sowie das System-Rescue und das Netinstall-Abbild stehen auf der Downloadseite des Projekts bereit.