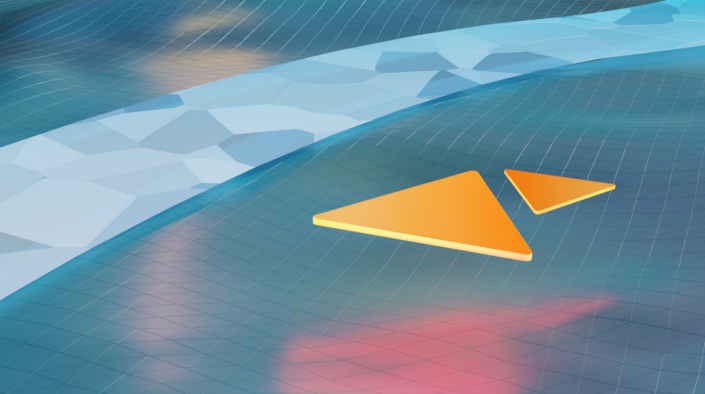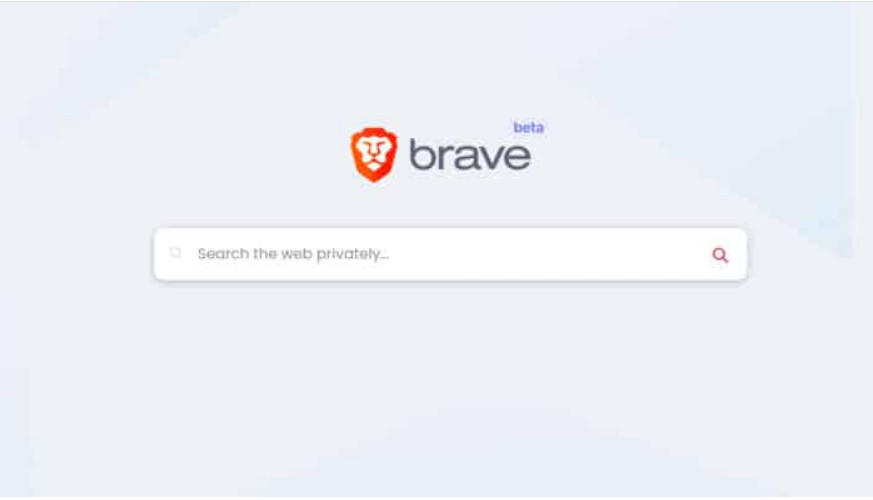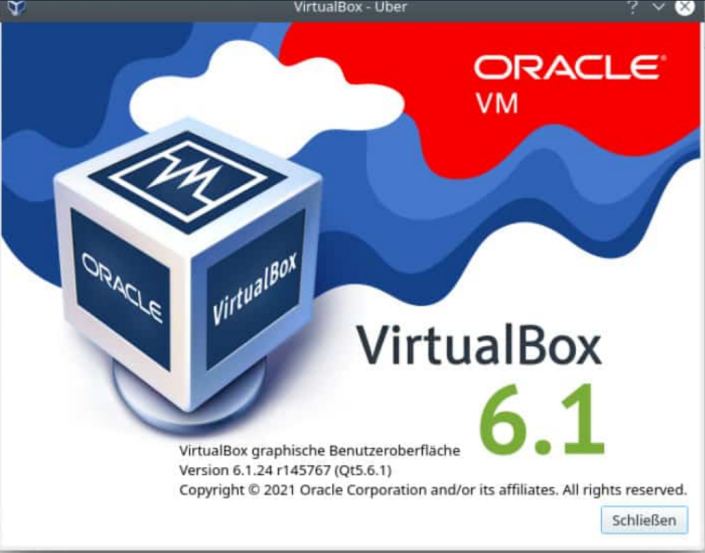Der seit 2015 ausgetragene Linux Presentation Day (LPD) findet zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst in Form vieler verteilter Veranstaltungen in deutschen und europäischen Städten statt und wird von den lokalen Linux User Groups (LUGs) organisiert und durchgeführt. Die Herbstausgabe 2021 findet am 13. und 20. November statt. Ziel des LPD ist es, Interessierten das alternative Betriebssystem in Vorträgen und im persönlichen Gespräch näherzubringen.
Veranstaltung am 13. November
Während der erste LPD 2021 wegen der anhaltenden Pandemie ein reines Online-Event war, versucht die zweite Ausgabe zumindest teilweise auch Präsenzveranstaltung zu sein. Die Veranstaltung am 13. November stellt den Online-Teil dar und stellt unter anderem Vorträge zu Linux als Videostream zur Verfügung. Wie bei vielen Linux- Konferenzen werden die Vorträge beim LPD aufgezeichnet und archiviert und sind auch später noch unter beim Mediendienst des CCC abrufbar. Noch ist das Programm nicht komplett, der Fahrplan stellt aber bereits teilnehmende LUGs und deren Programm vor.
Weitere LUGs sind aufgerufen, sich am Linux Presentation Day 2021.2 zu beteiligen. Als User Group kann man teilnehmen, indem man zum Beispiel
- eine Kennenlernrunde für die lokale LUG abhält (Meet-Kanal)
- eine Live-Session via Screensharing anbietet (Themen-Kanal)
- ein Video vorab einreicht und dann eine Q&A-Session als Videokonferenz anbietet
20. November: Präsenzveranstaltung
Wenn die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, sollen am 20. November in den teilnehmenden Städten Präsenzveranstaltungen stattfinden, damit Interessierte im direkten Gespräch mehr über Linux erfahren können. Wenn ihr also die Windows-Rechner von Verwandtschaft und Freunden nicht mehr weiter betreuen wollt, wisst ihr nun, wo ihr sie hinschicken könnt. Interessierte können bei ihrer lokalen LUG anfragen, ob eine Veranstaltung zum LPD 2021.2 geplant ist oder eine solche selbst anschieben.